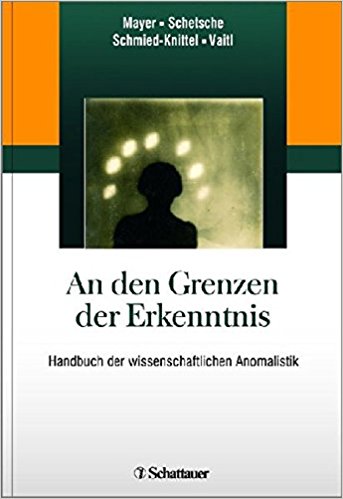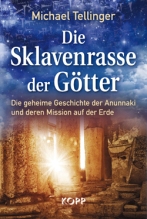Andreas von Rétyi
Auffälligkeiten in den Bahnen extrem ferner Kleinkörper des Planetensystems, weit jenseits der Neptunbahn, lassen eine jahrzehntelange Diskussion wieder aufleben: Gibt es in den Außenbezirken unseres Sonnensystems vielleicht noch größere, bislang unentdeckte Welten? Einige Fachleute, gegenwärtig vor allem spanische Astrophysiker, haben die Daten analysiert und vermuten tatsächlich, dass dort draußen sogar mehrere große Planeten existieren, darunter eine »Super-Erde«.

Nein, eine bewohnte Welt erwarten die Astronomen dort wohl kaum, immerhin aber einen oder mehrere Planeten von möglicherweise etlichen Erdmassen. Der Gedanke kam immer wieder auf: Jenseits des Neptuns könnte es nicht nur Kometen, Asteroiden und Zwergplaneten geben, sondern auch größere Welten. Die Suche erinnert an die ersten Erfolge der »Astronomie des Unsichtbaren«.
Nachdem Wilhelm Herschel im Jahr 1781 den Planeten Uranus entdeckt hatte, fielen bald Abweichungen in der Bahn jenes »Neulings« auf, die nur durch einen weiteren Planeten zu erklären sein konnten, einer größeren Masse, deren Schwerkrafteinwirkung Uranus vom zu erwartenden Kurs abbringt. Das war zumindest die nächstgelegene Erklärung.
Es mussten etliche Jahrzehnte vergehen, bis Berechnungen des französischen Mathematikers Urbain Le Verrier den Aufenthaltsort der störenden Masse ergaben und der Planet endlich gefunden war: Zusammen mit seinem Assistenten Heinrich Louis D’Arrest konnte der deutsche Astronom Johann Gottfried Galle den bislang noch unbekannten Planeten am 23. September 1846 von der Berliner Sternwarte aus identifizieren – Neptun war der erste Planet, der auf Grundlage mathematischer Berechnungen gefunden wurde.
Doch wies auch er Bahnstörungen auf. So ging die Suche bald weiter, bis dann mehr oder minder zufällig der nächste »Kandidat« gefunden wurde: Pluto. Nur war der viel zu klein, um für die Abweichungen verantwortlich zu sein. Zwar galt er seit seiner Entdeckung im Jahr 1930 als »neunter Planet« des Sonnensystems, wurde dann aber 2006 bekanntlich zum Zwergplaneten degradiert, da  er der nun strikteren Definition für einen Großen Planeten nicht mehr gerecht wurde.
er der nun strikteren Definition für einen Großen Planeten nicht mehr gerecht wurde.
Die ursprünglich registrierten Störungen in der Neptunbahn werden heute weitgehend als frühere Messfehler gewertet, dennoch geht die Planetensuche weiter – nach solchen Objekten, die weit genug entfernt sind, keinen feststellbaren Einfluss mehr auf die bekannten Bahnen weiter innen im Sonnensystem zu nehmen und die selbst mit heutiger Technik kaum zu finden sind. Allerdings könnten diese in sonnenferner Finsternis langsam umherziehenden Körper durchaus sehr groß sein und sich daher auch merklich auf Asteroiden und Zwergplaneten jener Regionen auswirken.
Genau solche Abweichungen werden tatsächlich beobachtet. Erst kürzlich haben die Gebrüder Carlos und Rául de la Fuente Marcos, zwei Forscher aus Madrid, zusammen mit dem pensionierten norwegischen Astrophysiker Sverre J. Aarseth erneut Berechnungen vorgelegt, die auf die Möglichkeit größerer Himmelskörper am Rande des Sonnensystems hindeuten.
Die Wissenschaftler haben sich die Bahndaten der fernsten Objekte vorgenommen und gründlich analysiert. Auffallend ist, dass alle bekannten Asteroiden und Zwergplaneten mit mittleren Sonnendistanzen von mehr als 150 Astronomischen Einheiten (1 AE entspricht der Distanz zwischen Erde und Sonne) sowie sonnennächsten Bahnpunkten (Perihelia) von über 30 AE ein Perihelargument um null Grad herum aufweisen.
Dieses »Argument« zählt zu jenen sechs Bahnelementen, wie sie die Bahn eines Himmelskörpers im Raum eindeutig festlegen. Es bezeichnet kurz gesagt den Winkel zwischen der Lage des Punktes, an dem der betreffende Orbit die Erdbahn nach Norden durchschneidet und dem Perihel. Für die Erde kann diese Definition natürlich nicht gelten, hier muss die Orientierung anders festgelegt werden.
Wesentlich bei allem ist jedenfalls die seltsame Häufung bei null Grad, sobald es um jene extrem weit entfernten Trans-Neptunier geht, kurz als ETNOs bezeichnet (Extreme Trans-Neptunian Objects). Nun gibt es eine verzerrende Beobachtungstendenz, durch die vor allem ekliptiknahe Objekte am Perihel beobachtet werden, eben bei den Argumenten null und 180 Grad.
Solche Bevorzugungen ähneln ein wenig dem »Straßenlaternen-Effekt«: Ein Polizist beobachtet einen Betrunkenen, wie er unter einer Straßenlaterne offenbar nach etwas sucht. Er fragt nach und der Mann erklärt, er habe seine Schlüssel verloren. Der Beamte schaut sich nun auch im Lichtkegel der Straßenlampe um. Nach einigen Minuten der erfolglosen Suche fragt der Polizist, ob er denn wirklich sicher sei, den Schlüssel hier verloren zu haben. Der Betrunkene verneint entschieden. Nicht doch, im Park habe er den Schlüssel verloren. Warum er dann aber hier auf dem Boden herumkrieche, will der Polizist wissen. Und der Betrunkene erwidert: »Hier ist halt Licht.« So in etwa verhält sich die Sache auch bei manchen Beobachtungstendenzen.
Interessanterweise aber finden sich bei 180 Grad keinerlei ETNOs. Die Forschergruppe folgert daraus, dass der beobachtete Überschuss von Objekten, die ihr Perihel nahe dem aufsteigenden Knoten und damit bei einem Perihelargument von null Grad erreichen, sich nicht durch einen Auswahleffekt erklärt, sondern völlig real ist.
So nehmen die Marcos-Brüder an, dass voraussichtlich zwei oder mehrere noch unbekannte, massereiche Himmelskörper für das Phänomen verantwortlich sind – ausgewachsene Planeten. Sie zwingen die ETNOs zu einem verräterischen Bahnverhalten, zu einer Verdichtung bei bestimmten Werten.
Das Verhalten ist bekannt. Es gibt eine periodische Störung im Orbit kleinerer Körper, die 1962 gefunden und nach ihrem japanischen Entdecker als »Kozai-Resonanz« oder »Kozai-Effekt« benannt wurde. Dieser Langzeitmechanismus »knetet« die Bahnen in bestimmten Situationen durch, wobei sich Ellipsenform und Bahnneigung voneinander abhängig entwickeln: Je elliptischer, desto weniger geneigt ist der Orbit – und umgekehrt.
Die spanischen Astronomen und ihr norwegischer Kollege studierten die Bahnentwicklung des 1986 entdeckten kurzperiodischen Kometen 96P/Machholz 1 und stellten dabei ein bemerkenswertes Muster fest: Der einige Kilometer große Komet, der unsere Sonne alle 5,3 Jahre umrundet, wird gegenwärtig von Jupiter in einer Kozai-Resonanz gehalten.
Sie äußert sich darin, dass das Perihelargument zum geringsten möglichen Perihel nahe null Grad liegt, bei geringer Bahnneigung und ausgeprägter Ellipse. Das Argument liegt aber bei 180 Grad, sobald das geringst mögliche Aphel als sonnenfernster Punkt eintritt, die Bahn relativ kreisförmig  ausfällt und ihre Neigung sehr hoch ist.
ausfällt und ihre Neigung sehr hoch ist.
Das alles klingt recht verwirrend, lässt aber vermuten, dass sich die Situation draußen im Sonnensystem wiederholen könnte. Statt Jupiter müssten hier dann andere massive Störenfriede in Erscheinung treten und die ETNOs auf eigenartige Wege lenken. Besonders erstaunlich eben auch das »Rollen« der Bahnen um ihre große Achse, wodurch die Argumente buchstäblich zwischen den Extremen hin- und herschaukeln.
Was könnte dort draußen also noch auf seine Entdeckung warten? Die Hinweise mehren sich, dass am Rand des Sonnensystems möglicherweise eine »Super-Erde« mit rund zehn Erdmassen existiert. Was die Eigenschaften einer solchen Welt betrifft, bleibt so einiges spekulativ, doch wird die Idee auch durch eine Entdeckung aus dem Jahr 2012 weiter genährt.
Damals, am 5. November, ging den Astronomen auf dem chilenischen Cerro Tololo ein besonderer Kleinplanet ins Netz, der die Bezeichnung 2012 VP113 erhielt. Dieses etwa 450 Kilometer große Objekt weist das fernste Perihel aller bekannten Asteroiden auf – es liegt bei 80,6 AE. Seine Bahn führt 2012 VP113 im Aphel bis auf die 446-fache Distanz Erde – Sonne hinaus.
Und wieder liegt das Perihelargument bei den verdächtigen null Grad. Wie im Falle der anderen Objekte, könnte eine Supererde hierfür verantwortlich sein. Einige Astronomen vermuten sie in etwa 250 AE Entfernung. Auch die Bahndaten des Zwergplaneten Sedna, der sogar bis auf 1000 AE von der Sonne abrückt, wurden ähnlich interpretiert.
Allgemein sind sich die Astronomen aber noch keineswegs einig, was in jenen düsteren Winkeln des Sonnensystems wirklich vor sich geht und wo nun welche Planeten zu vermuten sind. So wies der italienische Astrophysik-Professor Lorenzo Iorio entsprechende Berechnungen zurück, die eine Supererde von zwei bis 15 Erdmassen in einem Distanzbereich zwischen 200 und 300 AE nahelegen. Er nennt stattdessen völlig andere Werte – einen Planeten von zweifacher Erdmasse in rund 500 bis 600 AE sowie einen von 15-facher Erdmasse im Bereich von 1000 AE.
Noch liegen insgesamt einfach zu wenige Daten aus diesen Randbezirken unserer kosmischen Heimat vor. Die wenigen bekannten Objekte sorgen für Unsicherheit. Außerdem halten manche Fachleute den Gedanken für fraglich, dass in so enormen Distanzen einst noch große Planeten entstanden sein können. Immerhin aber zeigen aktuellere Beobachtungen um fremde Sonnen, dass dies offenbar grundsätzlich möglich ist.
Recht unkonventionell ging der britische Astronom John B. Murray das Problem an, wobei er allerdings eine andere Zielregion ins Auge fasste: 1999 studierte er zusammen mit seinem amerikanischen Kollegen John Matese langperiodische Kometenbahnen. Einige Besonderheiten ließen sie vermuten, dass die betreffenden Kometen von einem unbekannten Riesenplaneten auf enge Bahnen ins innere Sonnensystem abgelenkt wurden.
Nun ergibt sich für jenen Koloss, der vielleicht sogar die zehnfache Jupitermasse auf eine imaginäre Waage bringen würde, eine Entfernung von 30 000 bis 50 000 AE. Denn erst hier draußen existiert wohl jenes immense Kometenreservoir, das als »Oortsche Wolke« bekannt wurde.
Nur deutet gegenwärtig eben alles darauf hin, dass in solcher Sonnenferne keine Planeten mehr entstehen können. Woher also nehmen, wenn nicht stehlen? Im Prinzip wäre dies genau die Lösung, die Murray in den Sinn kam. In jenen fernen Zonen könnte ein fremder Planet aus dem interstellaren Raum ins Sonnensystem gelangt und hier verblieben sein.
Viele Fragen zu den exotischen Außenposten unseres Sonnensystems, genau solchen Objekten wie den langperiodischen Kometen und ETNOs, bleiben derzeit ungeklärt. Doch zeigen die jüngsten Beobachtungen, dass dort wohl noch etliche ungewöhnliche Himmelskörper ihrer Entdeckung »harren« dürften. Die Jagd nach Planeten jenseits von Neptun und Pluto wird sicher weitergehen.